In diesen Ländern ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen am größten
Nationen mit dem größten – und kleinsten – Gender Pay Gap

Überall auf der Welt verdienen Frauen weniger als Männer. Laut Daten der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) beträgt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen – neudeutsch: Gender Pay Gap – im weltweiten Durchschnitt etwa 20 Prozent.
Die niedrigen Gehälter von Frauen können auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt werden. So sind Frauen in gut bezahlten Führungspositionen beispielsweise unterrepräsentiert, während sie in Teilzeitstellen überrepräsentiert sind. Zudem ist Diskriminierung aufgrund bewusster und unbewusster Vorurteile ein Grund und die Tatsache, dass Frauen ihre Karriere häufiger unterbrechen als Männer, um sich um ihre Kinder, ältere oder kranke Familienmitglieder zu kümmern.
Hier schauen wir uns diese geschlechtsspezifische Entgeltlücke in 30 ausgewählten Ländern genauer an: Welche Nationen den größten bzw. den kleinsten Gender Pay Gap haben – und wie Deutschland dabei abschneidet.
Die Aufstellung basiert auf Zahlen der ILO, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie weiteren Datenquellen.
Adaptiert von Barbara Geier
Indien: 48,1 Prozent

Laut Angaben der ILO beträgt das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in Indien 48,1 Prozent. Damit ist das Land weit von einer geschlechtergerechten Bezahlung entfernt.
Vor allem im informellen Sektor sind Frauen besonders oft vertreten, das heißt viele von ihnen gehen einer Heimarbeit oder unbezahlten häuslichen Pflichten nach. Arbeitgeber bieten wenig Unterstützung für weibliche Beschäftigte und bezahlen Frauen für die gleiche Arbeit oft schlechter als ihre männlichen Kollegen. Auch in Führungspositionen sind Frauen in der indischen Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert.
Die indische Regierung versucht dem Lohngefälle zwischen Männern und Frauen mit Gesetzen entgegenzuwirken. Zudem wurden Initiativen wie „Skill India Mission“ gestartet, um die berufliche Qualifizierung von Frauen zu fördern. Ungeachtet dieser Maßnahmen ist die bestehende Lohnlücke so groß, dass es wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis sich an der Situation etwas ändert.
Südkorea: 31,2 Prozent

Mit 31,2 Prozent hat Südkorea den größten Gender Pay Gap aller OECD-Mitgliedstaaten. Hinter dieser großen Lohnlücke stecken weit verbreitete geschlechtsspezifische Vorurteile und die gesellschaftliche Erwartung, dass Frauen in Südkorea Aufgaben in den Bereichen Betreuung und Pflege übernehmen sollten. In südkoreanischen Unternehmen spielt zudem die Seniorität eine große Rolle, das heißt das Dienst- oder Lebensalter entscheidet über das berufliche Fortkommen. Frauen, die Kinder bekommen oder sich um Familienmitglieder kümmern müssen, sind damit automatisch benachteiligt.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich an dem bestehenden Gender Pay Gap in nächster Zeit etwas ändern wird, zumal die Regierung ein bestehendes Ministerium für Gleichstellungsfragen abschafft.
Sponsored Content
Südafrika: 30 Prozent

Der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen liegt in Südafrika laut Angaben der Statistikbehörde des Landes bei 30 Prozent. Der aktuelle „Global Gender Gap Report“ des Weltwirtschaftsforums geht von 23 bis 35 Prozent aus.
Weibliche Führungskräfte sind stark unterrepräsentiert und tragen zudem eine höhere Steuerlast als Männer. Frauen sind in der Regel zusätzlich mit Betreuungsaufgaben belastet: 48 Prozent der Haushalte, die von Frauen geführt werden, unterstützen Familienmitglieder. In von Männern geführten Haushalten liegt die Zahl bei nur 23 Prozent.
Japan: 21,3 Prozent

Japan hat ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von 21,3 Prozent – das größte aller G7-Staaten und fast doppelt so viel wie der OECD-Durchschnitt.
Laut Analysen des Software-Unternehmens PayAnalytics liegen die Hauptgründe für dieses Missverhältnis darin, dass Frauen besonders häufig in Teilzeit-, Zeit- und Vertragsarbeitsverhältnissen tätig sind und die Karriere vieler Frauen ins Stocken gerät. Obwohl ein Drittel der japanischen Vollzeitbeschäftigten Frauen sind, gibt es nur 9,4 Prozent weibliche Führungskräfte im Land. Die Regierung bemüht sich, diese Situation zu ändern. So müssen große Unternehmen nun beispielsweise in ihren Jahresberichten Angaben zum Gender Pay Gap in ihrer Organisation machen.
Kanada: 17,1 Prozent

Der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen in Kanada ist einer der größten unter den OECD-Mitgliedsländern. Aktuellen OECD-Daten zufolge beträgt er derzeit 17,1 Prozent, wobei die Lohnlücke in dem von Männern dominierten Energiesektor des Landes besonders hoch ist.
Gleichzeitig hat sich der Gender Pay Gap – auch durch entsprechende Gesetzgebung – in den letzten zwei Jahrzehnten verringert. So hat die kanadische Regierung 2021 ein Lohngleichheitsgesetz eingeführt, mit harten Strafen für Unternehmen, die diese Bestimmungen nicht einhalten.
Sponsored Content
USA: 17 Prozent

Die OECD weist aktuell für die USA einen Gender Pay Gap von 17 Prozent auf, der laut Angaben des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center in Amerika besonders hartnäckig ist und sich in den letzten zwei Jahrzehnten kaum verändert hat.
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, beispielsweise das sogenannte „Fatherhood Wage Premium“. Dieser Vaterschaftsbonus bezieht sich auf die höheren Gehälter, die erwerbstätige Väter im Vergleich zu erwerbstätigen Frauen und kinderlosen Männern erhalten.
Auch Diskriminierung gegen Frauen am Arbeitsplatz spielt weiterhin eine Rolle. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat daher unter anderem die Gleichstellung der Geschlechter in den Mittelpunkt ihrer Agenda „Invest in America“ gestellt.
Mexiko: 16,7 Prozent

Mexiko hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte bei der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen gemacht und schneidet laut der aktuellen OECD-Zahlen mit einem Gender Pay Gap von 16,7 Prozent jetzt besser ab als die USA.
Nichtsdestotrotz hat das Land noch einen langen Weg bis zur vollständigen Lohngerechtigkeit vor sich. Mexiko hat die drittniedrigste Frauenerwerbsquote aller OECD-Mitgliedsländer und einen hohen Anteil von Frauen, die im informellen Sektor tätig sind (z. B. unbezahlte häusliche Arbeit).
Im Land herrscht zudem eine Kultur langer Arbeitszeiten, die große Nachteile für Arbeitnehmerinnen hat, die sich zusätzlich um Kinder bzw. Familienangehörige kümmern.
Finnland: 15,3 Prozent

Der aktuelle finnische Gender Pay Gap von 15,3 Prozent erscheint auf den ersten Blick überraschend hoch, wenn man bedenkt, dass Finnland der Gleichstellung der Geschlechter bekanntermaßen eine hohe Priorität einräumt.
Gleiches Gehalt für Männer und Frauen ist in der Verfassung des Landes und in Gesetzen wie dem finnischen Gleichstellungsgesetz verankert. Dennoch ist die Kluft immer noch groß, z. B. weil nur wenige Frauen in Führungspositionen tätig sind. Laut Statista waren 2022 nur vier Prozent der finnischen CEOs weiblich, gleichzeitig gibt es einen hohen Anteil an weiblichen Teilzeitbeschäftigten.
Die finnische Regierung versucht diesem Zustand mit mehreren Maßnahmen entgegenzuwirken. Dazu gehören Gleichstellungspläne, Gehaltsanalysen und ein umfassendes Programm zur Lohngleichheit. 2022 hat die Regierungskoalition einen Vorschlag zur weiteren Verschärfung der Gleichstellungsvorschriften allerdings gekippt.
Sponsored Content
Großbritannien: 14,5 Prozent

Die aktuellen OECD-Daten weisen für Großbritannien einen Gender Pay Gap von 14,5 Prozent aus. Laut dem Dachverband britischer Gewerkschaften (Trades Union Congress) der gemeinnützigen Fawcett Society, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, sind die Fortschritte bei der Lohngleichheit in den letzten Jahren ins Stocken geraten.
Die britische Regierung hat zwar wichtige Maßnahmen eingeführt, wie beispielsweise Geldstrafen in unbegrenzter Höhe für große Unternehmen, die keine Statistiken über die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen vorlegen. Dennoch zahlen 80 Prozent der britischen Unternehmen laut Medienberichten ihren männlichen Angestellten immer noch mehr als weiblichen.
Schweiz: 13,8 Prozent

Wenn man bedenkt, dass Schweizer Frauen erst 1971 das Wahlrecht auf Bundesebene erhielten, hat das Land hinsichtlich der Frauenrechte einiges aufzuholen. Seit Juli 2020 sind strengere Vorschriften zur Förderung der Lohngleichheit von Frauen und Männern in einem Bundesgesetz zur Gleichstellung verankert.
Um das bestehende Lohngefälle zwischen Mann und Frau von – laut OECD – 13,8 Prozent zu verringern, muss allerdings noch mehr getan werden. Vor allem der hohe Anteil von Frauen in Teilzeitjobs ist ein Problem.
Deutschland: 13,7 Prozent

Mit 13,7 Prozent ist der deutsche Gender Pay Gap nur geringfügig kleiner als bei den Schweizer Nachbarn. Trotz entsprechender Gesetze und Verordnungen zur Reduzierung der Lohnlücke verdienen Männer nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in 45 von 46 Branchen immer noch mehr als Frauen.
Der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen ist dabei im Westen der Republik einschließlich Berlin mit 19 Prozent deutlich größer als im Osten mit nur sieben Prozent. Diese Diskrepanz hat teilweise damit zu tun, dass viele der größten Unternehmen des Landes, an deren Spitze nicht selten sehr gut verdienende Männer stehen, nach wie vor in den westlichen Bundesländern sind.
Sponsored Content
Niederlande: 13,2 Prozent

Der aktuell von der OECD ermittelte Gender Pay Gap von 13,2 Prozent hat sich in den Niederlanden in den letzten zehn Jahren kaum verändert. Das liegt vor allem am hohen Anteil von Frauen, die in Teilzeit beschäftigt sind.
Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Gehaltslücke im öffentlichen und im privaten Sektor. Laut niederländischem Statistikamt ist der Abstand zwischen Gehältern für Männer und Frauen im öffentlichen Sektor wesentlich geringer und hat sich in Führungspositionen sogar geschlossen.
China: 12,6 Prozent

Laut einer aktuellen Umfrage des Personalvermittlungsportals Zhaopin beträgt der Gender Pay Gap in China um die 12,6 Prozent, was fast eine Halbierung des für 2019 gemeldeten Wertes von 23,5 Prozent bedeutet.
Die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen wird nach wie vor größtenteils auf die Diskriminierung von Frauen im gebärfähigen Alter zurückgeführt. Trotz gesetzlicher Vorschriften, die dies zumindest auf dem Papier verbieten, besteht das Problem in der Praxis weiterhin.
Wie eingangs erwähnt, ist die geschlechtsspezifische Gehaltslücke in den letzten Jahren kleiner geworden und 2020 wurde ein bestehendes Gesetz zum Schutz der Rechte und Interessen von Frauen um fast 30 neue Bestimmungen zum Schutz von Frauen am Arbeitsplatz ergänzt. Abzuwarten bleibt, ob das nachgebesserte Gesetz auch wirklich durchgesetzt wird.
Österreich: 12,2 Prozent

In Österreich verdienen Frauen im Durchschnitt 12,2 Prozent weniger als Männer. Dieser Wert liegt über dem OECD-Durchschnitt von 11,9 Prozent, aber knapp unter dem EU-Durchschnitt von 12,7 Prozent.
Analysen der österreichischen Bundesanstalt für Statistik zeigen, dass der Anteil der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, mit 79 Prozent im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 29,5 Prozent besonders hoch ist – was das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern erklären könnte.
Folgen Sie uns schon? Klicken Sie oben auf das Pluszeichen und lesen Sie mehr von loveMONEY
Sponsored Content
Frankreich: 11,6 Prozent

Der Gender Pay Gap in Frankreich liegt laut OECD derzeit bei 11,6 Prozent. Abgesehen davon, dass immer mehr getan werden kann, ist die französische Regierung bei der Problembekämpfung sehr proaktiv. Wenn Unternehmen Zielvorgaben, die auf dem staatlichen Gleichstellungsindex basieren, nicht erreichen, fallen Geldstrafen an.
Die inzwischen zurückgetretene französische Premierministerin Élisabeth Borne – die erst zweite Frau an der Spitze der französischen Regierung – kündigte im März 2024 zudem an, dass zuwiderhandelnde Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden würden.
Brasilien: 11,1 Prozent

Laut OECD-Angaben beträgt der Gender Pay Gap in Brasilien elf Prozent. Analysen der brasilianischen Organisation DIEESE zufolge, die Daten zu Themen rund um den Arbeitsmarkt und Gehälter erhebt, ist diese Diskrepanz in Sektoren wie dem Gesundheits- und Bildungswesen, in denen Frauen besonders häufig tätig sind, noch größer und liegt bei 32 Prozent.
Um die Gehaltslücke zu schließen, hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Juli 2023 ein Gesetz unterzeichnet, das eine Reihe von Maßnahmen zur Gewährleistung gleicher Löhne für Frauen und Männer enthält. Ebenso wie Vorschriften, die größere Unternehmen verpflichten, regelmäßig Daten zum Gender Pay Gap zu melden.
Australien: 9,9 Prozent

Frauen bekommen in Australien in der Regel ein um 9,9 Prozent niedrigeres Gehalt als Männer. Die Regierung des Premierministers Anthony Albanese hat die Abschaffung dieser Lohnlücke jedoch ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt.
So wurde im März 2023 ein Gesetz zur Gleichstellung am Arbeitsplatz verabschiedet, das Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten verpflichtet, ihre Gender Pay Gaps zu veröffentlichen. Weitere Maßnahmen sind ein besserer Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung und mehr bezahlter Elternurlaub.
Auf der Grundlage ihrer aktuellen Prognosen geht die Regierung davon aus, dass sie bis 2049 eine Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen erreichen wird. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass ein großer Anteil der derzeit arbeitenden Frauen bis dahin in Rente sein wird.
Sponsored Content
Island: 9,7 Prozent

Obwohl Island im „Global Gender Index“ des Weltwirtschaftsforums den Spitzenplatz als Land mit der größten Geschlechtergleichheit belegt, gibt es nach wie vor einen Gender Pay Gap von 9,7 Prozent – und die Regierung tut alles, um diese Lücke zu schließen:
Im Jahr 2017 war Island das erste Land, das von Arbeitgebern verlangte, Lohngleichheit nachzuweisen. Außerdem gibt es Vorschriften, dass mindestens 40 Prozent der Vorstandsmitglieder eines Unternehmens Frauen sein müssen. Dazu kommt, dass kein anderes Land der Welt die Kinderbetreuung so stark subventioniert wie Island.
Nichtsdestotrotz ist das Ziel der Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern noch nicht erreicht. Im Oktober 2023 schloss sich die damalige isländische Premierministerin Katrín Jakobsdóttir einem landesweiten Streik isländischer Frauen an, um für gleiche Bezahlung zu demonstrieren.
Neuseeland: 9.2 Prozent

Laut OECD-Analyse liegt der neuseeländische Gender Pay Gap bei 9,2 Prozent und ist damit zwar geringer als der des Nachbarn Australien, aber immer noch recht groß. Das neuseeländische Frauenministerium beziffert ihn etwas niedriger (8,6 Prozent).
Laut Ministerium verbringen Frauen mehr Zeit als Männer mit unbezahlter Arbeit sowie mit Fürsorge-Tätigkeiten wie Kinderbetreuung und Altenpflege. Ein Großteil der Entgeltlücke wird allerdings auf bewusste oder unbewusste Vorurteile zurückgeführt.
Die Regierung versucht, die Unterschiede durch verschiedene Initiativen zu überbrücken, wie beispielsweise einen Aktionsplan, der dafür sorgen soll, geschlechtsspezifische und ethnische Lohnunterschiede im öffentlichen Dienst zu beenden.
Polen: 8,7 Prozent

Mit 8,7 Prozent ist der Gender Pay Gap in Polen laut der aktuellen Zahlen kleiner als der OECD- und EU-Durchschnitt. Nachdem die von Donald Tusk geführte Oppositionspartei die jüngsten Parlamentswahlen gewonnen hat, sollte sich diese Lücke weiter verringern, denn entsprechende Maßnahmen gehörten zu den Wahlversprechen der Partei.
Tusk unterstützt die Einführung von Vorschriften zur größeren Lohntransparenz sowie die Überprüfung unterschiedlicher Gehälter für Frauen und Männer in öffentlichen Einrichtungen und staatlichen Unternehmen. Der Ministerpräsident wird sogar mit der Aussage zitiert, dass er die Frauenrechte für das wichtigste Thema in seinem Land halte.
Sponsored Content
Spanien: 8,1 Prozent

Um den Gender Pay Gap von 8,1 Prozent (OECD-Daten) zu reduzieren, hat Spanien in den letzten Jahren gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen. Dazu gehörten zwei königliche Dekrete, die 2020 verabschiedet wurden, um Gleichstellungspläne zu regeln und gegen geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung vorzugehen. Im letzten Jahr wurde zudem ein neues Gesetz zur Geschlechterparität in den Vorständen großer Unternehmen angekündigt.
Irland: 7,3 Prozent

In Irland liegt der Gender Pay Gap laut den aktuellen OECD-Zahlen bei 7,3 Prozent. Seit der Einführung entsprechender Vorschriften im Dezember 2022 müssen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten auf ihrer Website Informationen zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen veröffentlichen. Nach Angaben der „Irish Times“ zahlen viele der wichtigsten Arbeitgeber des Landes Männern mehr als Frauen.
Es gibt aber auch Ausnahmen wie die irische Post „An Post“, die Frauen in der Regel einen höheren Stundenlohn zahlt als Männern. Die „Irish Times“ berichtet aber auch, dass nur 13 Prozent der Beschäftigten bei der irischen Post Frauen sind und viele davon Führungspositionen innehaben.
Malaysia: 7,3 Prozent

Laut aktueller Daten des malaysischen Amtes für Statistik verdienen Frauen im Schnitt 7,3 Prozent weniger als Männer. Als Gründe werden Stereotypen über traditionelle Frauenrollen und Diskriminierung bei der Ausbildung angeführt, ebenso wie die Trennung von Frauen und Männern in unterschiedliche Berufe bzw. Berufsgruppen (sogenannte Geschlechtersegregation). Nicht zuletzt wird die ungleiche Entlohnung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit genannt.
Obwohl die Lohnlücke in Malaysia im Vergleich zu vielen anderen auf dieser Liste gering ist, könnte die Regierung noch mehr tun, um sie zu schließen. So gibt es in Malaysia beispielsweise noch keine Gesetze zur Chancengleichheit im Arbeitsalltag und zur Lohngerechtigkeit.
Sponsored Content
Schweden: 7,2 Prozent

Schweden ist ein Vorreiter bei der Geschlechtergleichstellung. Das Land ist in allen Bereichen – von Mutterschaftsurlaub bis zur Kinderbetreuung – führend. Einen Gender Pay Gap gibt es allerdings trotzdem und laut OECD liegt er derzeit bei 7,2 Prozent.
Dies ist zum einen auf den hohen Anteil an Frauen in Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen. Außerdem waren laut Angaben des schwedischen Amts für Statistik bereits 2020 67 Prozent der Führungspositionen im öffentlichen Sektor mit Frauen besetzt.
Im privaten Sektor sieht das anders aus: Nur zehn Prozent der an der Stockholmer Börse notierten Unternehmen haben eine weibliche Vorstandsvorsitzende, nur 13 Prozent haben einen weiblichen CEO und nur 36 Prozent der Vorstandsmitglieder sind Frauen.
Singapur: 6 Prozent

Laut Angaben des Ministeriums für Arbeit in Singapur liegt der Gender Pay Gap in dem Stadtstaat bei sechs Prozent. Ein Report des Ministeriums führt die Diskrepanz darauf zurück, dass Frauen oft die Hauptrolle bei der Kinderbetreuung spielen und dafür eine Auszeit von der Arbeit nehmen. Daher haben sie weniger Berufserfahrung und ihre Karriere kommt langsamer voran, was im Endeffekt zu einem niedrigeren Gehalt führt.
Zudem geben nur 46 Prozent der Frauen in Singapur an, dass sie kein Problem damit haben, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zum Vergleich: Bei den Männern sagen dies 63 Prozent. Auch diese Zurückhaltung dürfte zu den Unterschieden bei der Bezahlung beitragen.
Italien: 5,7 Prozent

Der italienische Gender Pay Gap von 5,7 Prozent ist einer der kleinsten in Europa.
In der Privatwirtschaft ist er allerdings größer. Auf dem italienischen Arbeitsmarkt fehlt die Chancengleichheit für Frauen und in Führungspositionen sind sie unterrepräsentiert. Maßnahmen, die von der Regierung während der Corona-Pandemie ergriffen wurden, tragen jedoch erheblich zur Verbesserung bei.
Sponsored Content
Dänemark: 5,6 Prozent

Dänemark ist ein Pionier, wenn es um Frauenrechte geht. Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert ist das Land weltweit führend bei der Gleichstellung der Geschlechter. Damals wurde ein Gesetz eingeführt, das sowohl Jungen als auch Mädchen Anspruch auf eine mindestens siebenjährige Schulbildung einräumte.
Heute ist der Anteil dänischer Frauen, die außer Haus arbeiten, einer der höchsten der Welt. Wenig überraschend also, dass der Gender Pay Gap des Landes von 5,6 Prozent einer der kleinsten in der EU ist.
Bei all diesen guten Nachrichten bleibt aber auch zu sagen, dass der dänische Arbeitsmarkt stark segregiert ist. Während Frauen im öffentlichen Sektor überrepräsentiert sind, insbesondere im Gesundheitswesen, sieht es in der Privatwirtschaft umgekehrt aus. Vor allem in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sind sie unterrepräsentiert.
Norwegen: 4,5 Prozent
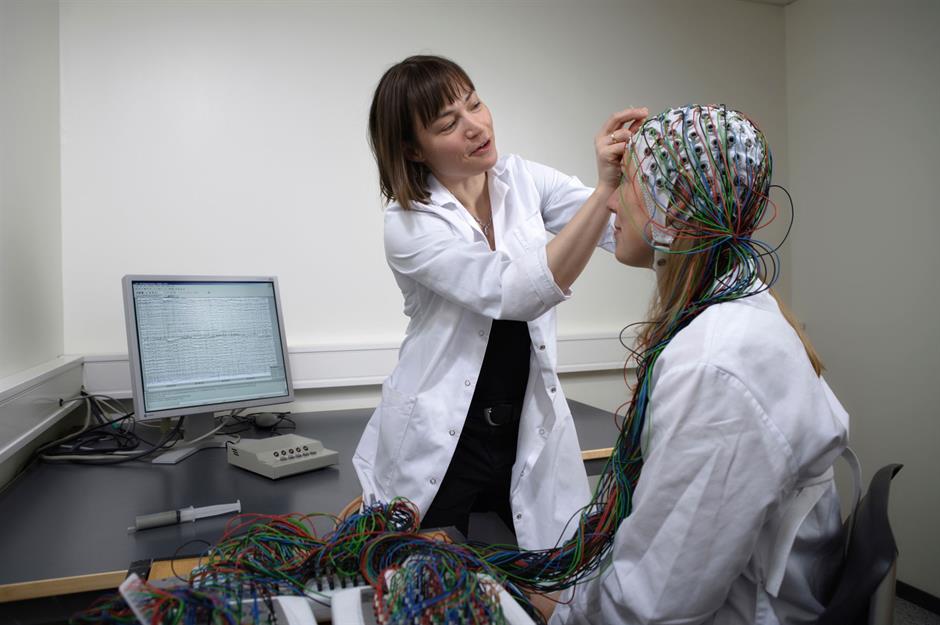
Wie die anderen skandinavischen Länder ist auch Norwegen weltweit führend bei der Gleichstellung der Geschlechter und der Gender Pay Gap ist mit nur 4,5 Prozent relativ klein.
Trotz dieser positiven Zahl muss aber auch Norwegen noch einiges tun, bevor eine komplette Parität erreicht wird. Wie in Dänemark ist der stark nach Geschlechtern getrennte Arbeitsmarkt ein Thema: Frauen dominieren nach wie vor im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Bildungswesen, während Männer in den Bereichen Bau, Industrie und Verkehrswesen überrepräsentiert sind.
Kolumbien: 1,9 Prozent

Der von der OECD ermittelte kolumbianische Gender Pay Gap von 1,9 Prozent ist bemerkenswert klein.
Neuere Analysen deuten allerdings darauf hin, dass Frauen auch in Kolumbien an die berühmte gläserne Decke stoßen, die an einem bestimmten Punkt den weiteren beruflichen Aufstieg erschwert, und sie am Arbeitsplatz Diskriminierung erfahren können. Dennoch: In der Hauptstadt Bogotá verdienen Frauen in Führungspositionen im Durchschnitt mehr als ihre männlichen Kollegen.
Sponsored Content
Belgien: 1,2 Prozent

Mit nur 1,2 Prozent hat Belgien den kleinsten Gender Pay Gap aller OECD-Mitgliedstaaten.
Laut Zahlen der Statistikbehörde des Landes verdienen Frauen unter 25 Jahren mehr als Männer derselben Altersgruppe. In der Region Wallonien erhalten weibliche Beschäftigte sogar in allen demografischen Gruppen, von Generation Z bis Baby Boomer, ein höheres Gehalt als männliche Mitarbeiter.
Folgen Sie uns schon? Klicken Sie oben auf das Pluszeichen und lesen Sie mehr von loveMONEY
Comments
Be the first to comment
Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature